„Wir wollen keine Bestenliste“
Von Elena Philipp & Georg Kasch
Elena Philipp und Georg Kasch sprachen mit Kai van Eikels über sein Forschungsvorhaben „Förderung von künstlerischen Produktionen unter veränderten Vorzeichen“, das als eines der 12 Teilstudien im Rahmen des Forschungsprogramms des Fonds die künstlerische Entwicklung und Förderperspektive in den Freien Darstellenden Künsten untersucht.
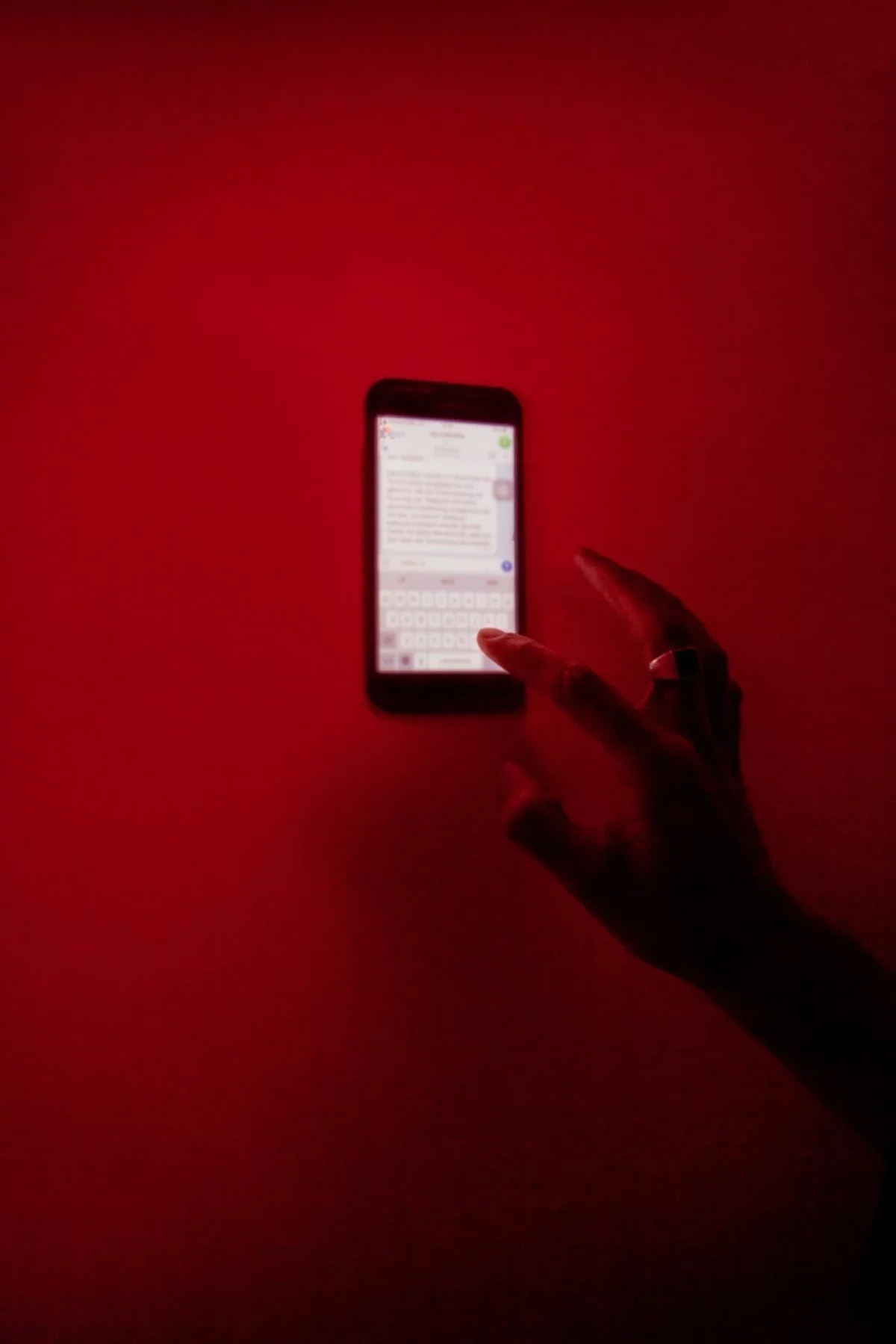 © Louisa Marie Nübel
© Louisa Marie Nübel
Kai van Eikels im Gespräch über seine #Take-Forschung, künstlerische Entwicklungen und Förderperspektiven
Parallel zu seinen #Take-Förderprogrammen hat der Fonds Darstellende Künste zwölf Teilstudien in Auftrag gegeben, um zu erforschen, wie die Gelder wirken und ob sich die positiven Effekte verstetigen lassen. Prof. Dr. Kai van Eikels von der Ruhr-Universität Bochum leitet die Teilstudie „Förderung von künstlerischen Produktionen unter veränderten Vorzeichen“. Gemeinsam mit der Theatermacherin und Kulturwissenschaftlerin Laura Pföhler und dem Dramaturgen, Regisseur und VR-Künstler Christoph Wirth führt er Interviews, sichtet Mitschnitte und Livestreams, um herauszufinden, was sich durch die Förderung in den Arbeitsweisen der Künstler*innen verändert. Erste Einblicke in die Forschungsstände gewähren die Wissenschaftler*innen beim Bundesforum, vom 14.-16. September 2021 im Radialsystem und in Netz.
Kai van Eikels, Corona hat in den darstellenden Künsten alles durcheinandergewirbelt. Sie gewinnen dank Ihrer Forschung gerade einen Überblick: Wie steht es um die Freie Szene?
Sehr gut! Es gibt viele interessante Reaktionen gerade auf Probleme und Schwierigkeiten, die unter Corona-Bedingungen entstanden sind. Wir sind mit unserer Studie auf der Suche nach good practices: Was sind gute Reaktionen auf die durch Corona veränderten und erschwerten Bedingungen in den Live Arts? Was ist möglicherweise so gut, dass man es nach der Eindämmung der Pandemie weiterverfolgen könnte? Gut heißt für uns: dass die Beispiele über die einzelne künstlerische Arbeit hinaus Wege aufzeigen, die auch andere gehen könnten. Wir sind nicht an Brillanz bestimmter Aufführungen oder Konzepte interessiert. Sondern an Praktiken, die zu Veränderungen beitragen können.
Was verstehen Sie unter Live Arts?
Schauspiel, Tanz, Performance, Objekt- und Figurentheater, experimentelle Formen von Zirkus und Projekte, die mit künstlerischen Arbeiten in den sozialen und politischen Bereich hineingehen. Davon versuchen wir möglichst viel zu überblicken. Wir drei haben alle etwas unterschiedliche Präferenzen und künstlerische Sozialisierungen. Außerdem fragen wir die Leute, deren Arbeiten wir interessant finden, was sie gesehen haben. Teilweise holen wir uns bewusst Expertise dazu, für Kinder- und Jugendtheater oder Zirkus etwa. Grundsätzlich ist die Auswahl subjektiv. Aber wir wollen keine Bestenliste aufstellen oder Jurypreise vergeben. Das ist eine Studie, die für Künstler*innen der Freien Szene gedacht ist. Idealerweise wird das, was wir als Text produzieren, anregend zu lesen sein, um zu erfahren: Was machen die anderen? Woran können wir anknüpfen? Was können wir variieren? Damit verknüpft ist die Frage, inwieweit die Förderinstrumente die Bedarfe abdecken. Welche Möglichkeiten gibt es, noch präziser zu fördern?
Gibt es in Sachen Förderbedarf eine Arbeitshypothese?
Unsere Hypothese ist, dass das projektorientierte Schreiben von Anträgen zurückwirkt auf die Art, wie produziert wird. Viele Projekte greifen Themen auf, die in den Nachrichten besprochen werden, weil es einfach ist, darüber Relevanz herzustellen. Es sind Themen, zu denen die fertigen Produktionen mitunter wenig beizutragen haben. Die Gefahr ist, dass die Kunst ein parasitäres Verhältnis zur Wirklichkeit eingeht. Eine unserer Fragen ist: Wie kommen wir von Thematismus weg? Dazu braucht es vielleicht langfristig mehr Sicherheit in der Förderung. Wenn man sich um die Miete sorgt, ist das keine gute Voraussetzung, sich mit dem Potenzial der eigenen künstlerischen Arbeit zu befassen.
Wie könnte eine andere Förderung konkret aussehen?
Die Freie Szene steckt ja in so einer Eine-Gruppe-ein-Projekt-Logik drin. Wir denken, dass die Förderung von langfristigen und kollektiven Rechercheprozessen verstärkt werden sollte. Auch so etwas wie künstlerische Forschungszusammenhänge – in Analogie zu dem, was in der Wissenschaft an Verbundforschung möglich ist. Das könnte man finanziell stimulieren. Auf dem freien Markt konkurrieren Künstler*innen, Gruppen und Institutionen um Fördermöglichkeiten – Kooperationen sind da bislang eher strategische Zusatzoptionen. Es geht darum, jenseits dieser Konkurrenz, dieser Abhängigkeiten von der Projektförderung, diesem Projektkapitalismus Zusammenarbeit zu ermöglichen. Da braucht es mehr Sicherheit, mehr Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit auch im ökologischen Sinn?
Nachhaltigkeit ist ein Stichwort für die gesamte Studie. Es gibt ein Teilprojekt von Sandra Umathum und Maximilian Haas, das sich mit Nachhaltigkeit aus ökologischer Perspektive beschäftigt. Generell stellt sich die Frage, wie wir nachhaltige, kooperative Arbeitsweisen finden. Wie kommen wir weg von der Projektbezogenheit?
Ein Teil Ihrer Forschung besteht darin, sich aktuelle Inszenierungen anzuschauen. Was sind für Sie erste interessante Ergebnisse?
Ein Punkt wäre im Anschluss an den Begriff Live Art: Was bedeutet Liveness unter den aktuellen Bedingungen? Viele Aufführungen und Probenprozesse finden momentan online statt. Unsere Arbeitshypothese war ganz offen: Live ist erstmal alles, was sich live anfühlt für die Beteiligten. Bei Liveness geht es entscheidend darum, wie das, was jemand tut, meine Imagination anspricht. Vielleicht wird die Grenze zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Körpern durchlässiger. Viele Informationen, die Körper einander mitteilen, wenn sie in einem Raum sind, gehen beim Streaming verloren. Aber vielleicht werden Objekte, auf die sich die Kamerabewegung richtet, oder Bots stärker zu Akteur*innen? Wir wissen aus anderen Bereichen der Onlinekultur, zum Beispiel aus ASMR-Videos, dass Präsentationen von Objekten zum Teil starke affektive Reaktionen auslösen und Menschen starke Bindungen zu Dingen entwickeln.
Hat sich dadurch auch ästhetisch etwas verändert?
Viele Menschen, die sich abends als Publikum zur Aufführung einfinden, haben da Zoom schon den ganzen Tag benutzt. Eine Reaktion darauf ist, sich auf das Hören zu verlagern, auf Stimmen, die einem etwas erzählen. Das Telefongespräch erlebt ein Comeback, weil es oft eher in der Lage ist, Intimität herzustellen. Das sind Formate, die nicht neu sind, aber die unter gegenwärtigen Bedingungen eine neue Art von Interessantheit gewinnen – weil Stimmen etwas Wohltuendes bekommen. Es gibt auch sehr anregende Übertragungen, etwa eine Arbeit, in der jemand im Rollstuhl seine Fahrt entlang einer Küste beschreibt. Das wird per Livestream in ein Studio übermittelt, in dem Performer*innen das Geschilderte in Bewegungen und Klänge übersetzen und die Zuschauer*innen dann diese Performance erleben. Wo also auch die Körper der Performenden zu Medien werden, die etwas übertragen.
Werden bereits neue Formen des Zusammenarbeitens, des Vernetzens sichtbar, zum Beispiel weil eine Gruppe, die noch nie online gearbeitet hat, sich plötzlich Spezialist*innen dazu holt?
Das Verhältnis zu Technik ist ein wichtiger Aspekt unserer Studie. Das betrifft die Künstler*innen sowohl als User*innen vorhandener Hard- und Software wie auch als aktive Mitgestalter*innen von Technologie: Wie gehen sie mit Programmen um, die Aufführungssituationen teils stark strukturieren? Gibt es im Gebrauch Freiheiten, die man sich erarbeiten kann? Dann zeigt sich, dass manche anfangen, Programme zu entwickeln – wie machen sie das? Werden Kooperationen mit Leuten wichtiger, die technische Kompetenz einbringen? Machen sie Schulungen, holen sie sich jemanden dazu? Das wirkt sich ja auch auf den Förderbedarf aus.
Das ist die personelle Seite. Welche künstlerischen Entwicklungen gibt es?
Durch den Umgang mit Technik entsteht natürlich auch ästhetisch etwas. Es gibt zum Beispiel eine Arbeit, in der lernfähige Algorithmen darüber entscheiden, was von einer Aufführung gespeichert wird – da kommt eine dritte Instanz des Gedächtnisses dazu neben Publikum und Performer*innen. Das könnte das Wesen von Live Art verändern. Insbesondere interessiert es uns, wenn Technik die Imagination fördert. Wie werden Bots eingesetzt? Wie Kommunikationssituationen geschaffen, in denen unentscheidbar ist, ob die anwesenden Kommunizierenden Publikum, Performer*innen oder Bots sind? Es gibt interessante Arbeiten, die Rollenspielsituationen schaffen, in denen sich ein Misstrauen entwickelt: Mit wem rede ich eigentlich? Dabei entdeckt man auch, wie botmäßig die eigene Kommunikation ist und wie leicht es ist, bestimmte Strukturen zu reproduzieren.
Apropos künstlerische Entwicklung: Haben die Neustart-Kultur-Förderungen in erster Linie die Künstler*innen aufgefangen? Oder haben sie auch künstlerische Innovationen ermöglicht, die zuvor so nicht möglich waren?
Die Förderung war extrem wichtig, so mein Eindruck, um die Leute aufzufangen. Wir dürfen nicht vergessen, dass in der Freien Szene viele Leute unter prekären Bedingungen arbeiten und nicht in der Lage sind, groß Vermögen anzusparen. Nachdem den Geförderten klar wurde, dass es das Geld gibt und man sich damit eine Weile über Wasser halten kann, sind die Leute entspannter und deshalb neugieriger mit der Situation umgegangen, haben sich spielerisch und forschend auf die Situation eingelassen.
Gibt es durch Corona einen Paradigmenwechsel in den Live Arts?
Das wissen wir noch nicht. Dafür ist unsere Arbeit an der Studie noch nicht weit genug. Was sich schon abzeichnet, sind gewisse Entwicklungen, die bereits vor der Coronakrise da waren und die sich jetzt beschleunigt haben. Zum Beispiel werden wir, denke ich, in zehn Jahren einen deutlich weiteren Begriff von Skript haben. Der bewegt sich ja schon seit Jahrzehnten weg vom literarischen Text als Drama und hin zum Text als Material. Dazu kommt aktuell das Schreiben von Code, also Text, der von Maschinen gelesen und vollzogen wird. Ich denke, dass sich diese Dimensionen von Text in Zukunft enger verschränken werden und dass die Ästhetik der Live Arts prägen wird. Außerdem werden wir ein sehr viel ökologischeres Verständnis von Live Art haben.
Inwiefern?
Den Ort, an dem Live Arts stattfinden, werden wir nicht mehr als “empty space“ begreifen können, der für das Mögliche leergeräumt wurde, sei es institutionell oder imaginär. Sondern als ein Milieu, einen Raum, in dem schon etwas lebt und zusammenlebt. Die künstlerische Handlung, die ästhetische Form wird sich da hineinfinden, im infrastrukturellen, technischen, ästhetischen Sinne. Was künstlerische Form ausmacht, wird sich nicht mehr unabhängig von ökologischen Fragestellungen beantworten lassen.
Haben Sie den Eindruck, dass man mit der Studie wirklich etwas verändern kann, zum Beispiel, indem man mit ihr politischen Druck ausübt?
Für mich war es eine Motivation, an der Studie mitzuwirken, dass hier etwas für die Freie Szene getan wird, das nachwirkt und die Situation verbessert. Ich habe schon den Eindruck, dass es Möglichkeiten gibt, neue Förderformate vorzuschlagen. Man kann die Strukturen so verändern, dass auf der einen Seite mehr künstlerische Qualität entstehen kann und auf der anderen Seite weniger vorauseilender Gehorsam. Man muss Situationen schaffen, die die Leute ermutigen, weniger gehorsam zu sein.
Zum Beispiel?
Die Antragstellung ist momentan sehr träge, die Live Arts politisch oft sehr brav. Ich könnte mir zum Beispiel als Gegengewicht zu den langfristigen Förderungen eine Förderung für kurzfristige Interventionen vorstellen, ohne lange Antragsprozedur, auf Risiko gehen, indem man Leute auswählt, denen man zutraut, intuitiv gut auf eine aktuelle Situation zu reagieren. Denen gibt man dann einfach eine bestimmte Geldsumme und guckt, was sie draus machen. Ich bin jetzt kein Kulturpolitiker. Aber ich glaube, dass es eine realistische Chance gibt, die Arbeitsbedingungen für die Künstler*innen zu verbessern. Jedenfalls solange es das bedingungslose Grundeinkommen noch nicht gibt. Denn das wäre ja das eigentliche Ziel: in einer Situation leben zu können, in der man keine Angst haben muss, morgen die Miete nicht mehr bezahlen zu können.